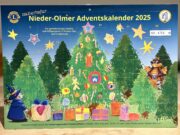VG NIEDER-OLM – Die Verbandsgemeinde (VG) Nieder-Olm macht sich bereit für die Wärmewende. Fachleute und Verwaltung haben bei einer Informationsveranstaltung den aktuellen Stand der kommunalen Wärmeplanung (KWP) vorgestellt. Rund 30 Interessierte stellten im Ratssaal bisweilen sehr spezifische Fragen und machten damit deutlich, dass das Thema nicht wenigen unter den Nägeln brennt, ja, zu langsam geht.
Projektleiterin Theresa Wehmeier von der EWR Climate Connection musste mehrfach betonen, dass sich die Planung noch in einer frühen Phase befindet. Damit reagierte sie auf die Statements aus dem Publikum, es gebe wenig Konkretes zu hören. Gleichwohl lieferte Geschäftsführer Marcus Wagner des Dienstleisters viele Antworten. „Wir stehen am Anfang, aber wir geben Orientierung“, so Wehmeier. Es gehe darum, den Bürgern Perspektiven aufzuzeigen – keine festen Vorgaben zu machen. Ziel ist es, herauszufinden, wie vor Ort die Wärmewende gelingen kann. Dabei gehe es auch nicht um einzelne Gebäude, vielmehr um ganze Gebiete.
Die kommunale Wärmeplanung ist Teil der bundesweiten Strategie, bis 2045 klimaneutral zu sein. Dazu wird in mehreren Schritten gearbeitet: zunächst der Ist-Zustand erhoben, dann das Potenzial analysiert, schließlich ein Zielszenario entworfen, das in ein Konzept für die nachhaltige Wärmeversorgung mündet. „Die kommunale Wärmeplanung liefert einen Fahrplan für die Zukunft“, sagte Wehmeier.
Eine digitale Landkarte, ein sogenannter „digitaler Zwilling“, veranschaulichte das Vorhaben: Sie bündelte Daten zu Energieverbrauch, Gebäudebestand und möglichen CO₂-Einsparungen. Daraus lasse sich ableiten, wo Wärmenetze sinnvoll sind oder wo individuelle Lösungen besser passen, erklärte Wehmeier. „Wir schauen, wo sich Bürger zusammenschließen können, um gemeinsam nachhaltiger zu heizen.“ Ob solche Netze wirklich gebaut werden, hängt laut Beraterin Jessica Scherer von vielen Faktoren ab – von der technischen Machbarkeit bis zur Unterstützung durch Bürger und Investoren.
Sie führte die Teilnehmer durch den „dichten Gesetzeswald“ an Vorgaben, erklärte, dass das Heizen derzeit 70 Prozent der CO₂-Emissionen verursacht – und damit das größte Einsparpotenzial bietet. „Steigende CO₂-Preise, höhere Netzentgelte, weltweite Krisen: Wer hier nicht mitzieht, zahlt künftig mehr“, warnte sie. Deshalb solle jeder Haushalt prüfen, wie er effizienter heizen kann.
„Wir prüfen die Eignung von Wärmenetzen, aber gebaut wird nur, wenn alle mitmachen“, fuhr Scherer fort. Die Wärmeplanung schafft dafür die Grundlagen. Doris Leininger-Rill (FWG), Beigeordnete der VG, ergänzte den Aspekt: „Die Kommune bietet keine individuelle Beratung. Dafür gibt es unabhängige Energieberater oder die Verbraucherzentrale.“ Die kommunale Wärmeplanung sei ein strategisches Instrument, das alle fünf Jahre überprüft werde und den Flächennutzungsplan ergänzt.
Trotz mancher Unsicherheit: Die Fragen der Bürger zeigten das stetig wachsende Interesse am Thema. „Es gibt viele offene Punkte, aber wir haben heute Grundlagen vermittelt“, bilanzierte Wehmeier. Weitere Workshops sollen folgen, und Ende 2025 soll ein Abschlussbericht vorliegen, der die Ergebnisse der bisherigen Analysen bündelt.
Gregor Starosczyk-Gerlach