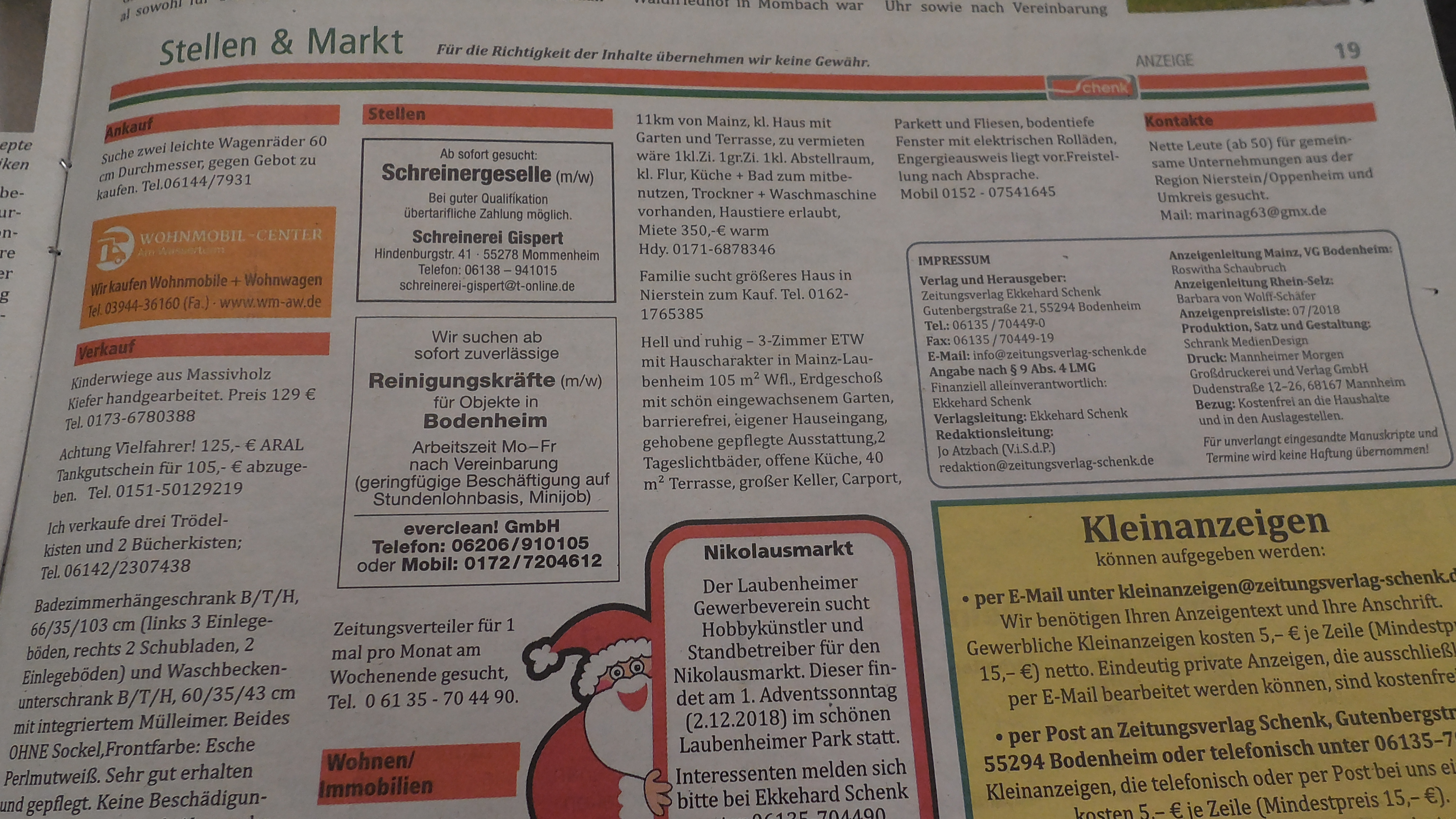NIERSTEIN – Unter dem Titel „Erinnerungskultur in Familien“ zeigt der Geschichtsverein im Rathaus Nierstein sechs Wochen lang eine Ausstellung, die private Objekte, Familiengeschichten und biografische Zeugnisse miteinander verbindet. Die Schau, die anlässlich des Jahrestages der Judenpogrome von 1938 nach Nierstein kam, entstand in Kooperation mit dem Landtag Rheinland-Pfalz und der Universität Koblenz. Ihr Ansatz lautet: „Grabe, wo du stehst“ – Geschichte dort aufspüren, wo sie wirkt, in Familien, in Dingen, in persönlichen Erinnerungen. Eröffnet wurde sie mit einem Vortrag von Holocaustforscherin Dr. Inka Engel, die die wissenschaftlichen Grundlagen der zugrunde liegenden Studie vorstellte.
In seinem Redebeitrag erinnerte Hans-Peter Hexemer vom Geschichtsverein daran, wie schwer sich viele Familien nach 1945 taten, über ihre Erfahrungen zu sprechen. „Keiner war dabei“ – eine Haltung, die Jahrzehnte prägte. Erst Richard von Weizsäckers Rede am 8. Mai 1985 habe dieses Schweigen gebrochen und den Blick auf den Tag als Befreiung gelenkt: Befreiung von Krieg und Terror, aber auch Befreiung hin zu Demokratie und Verantwortung. Die Ausstellung knüpfe daran an, weil sie persönliche Spuren freilege, die Geschichte greifbar machen.
Hexemer stellte drei Objekte vor, die in einer der Vitrinen zu sehen sind. Ein Buch des Autors Franz Mehring, dessen Werke 1933 verbrannt wurden, hat sein Großvater auf dem Speicher versteckt und damit bewusst bewahrt. Ein Tintenfass des jüdischen Bürgers Jakob Hirsch, Mitglied der Metzgerfamilie Koch-Hirsch, erinnerte an die Freundschaft mit seinem Berufskollegen Georg Strub. Jakob Hirsch überlebte die Lager als einziger seiner Familie.
Joachim Allmann, der Ortsvorsteher von Schwabsburg, der Stadtbürgermeister Jochen Schmitt vertrat, dankte dem Geschichtsverein für dessen Engagement und betonte, wie wichtig dessen Arbeit für die lokale Erinnerungskultur sei. Erinnerung, sagte Allmann, entstehe nicht nur im Geschichtsbuch, sondern im Alltag, in Gesprächen, in Familien. Ein Gegenstand bekomme erst dann Bedeutung, wenn man seine Geschichte kenne. Ohne Kontext sei vieles „alter Kram“, mit Kontext aber ein Zeugnis eines Schicksals.
Ein eindrückliches Exponat der Schau ist eine kleine schwarze Umhängetasche mit einem Arbeitsbuch. Sie erzählt die Geschichte eines 1908 geborenen Polizeibeamten aus Andernach, der 1933 als politisch unzuverlässig entlassen wurde, weil er Sozialdemokrat und Gegner des Regimes war. Er und seine Frau schlugen sich als „Warenverteiler“ durch, belieferten Krankenhäuser und Betriebe mit dem Fahrrad. Die Tasche diente als Kasse und mobiles Büro. Nach 1945 wurde er wieder eingestellt. Heute bewahrt sein 86-jähriger Sohn die Tasche und ein Foto des Vaters auf.
Engel führte aus, dass die Studie, auf der die Ausstellung beruht, unterschiedliche Muster des familiären Erinnerns feststellte. Einheimische Familien erzählen oft von Krieg und Nachkriegszeit; der Holocaust spielt in ihren Erzählungen meist nur eine Nebenrolle zeigt. „Familien mit Migrationsgeschichte verbinden eigene Fluchterfahrungen mit Erlebnissen rassistischer Diskriminierung in Deutschland.“ Jüdische Familien erinnern den Holocaust stärker, klarer und mit Fokus auf den Opfern. „Die quantitativen Daten zeigen aber, dass viele Menschen zwar gut über die NS-Zeit informiert sind, aber keinen Bezug zu ihrer eigenen Gegenwart oder Zukunft sehen.“ Mehr als ein Viertel sei unsicher, ob die Ereignisse von damals heute noch Wirkung haben.
Gerade deshalb fordert laut Engel die Studie, Ambivalenzen offen anzusprechen und Erinnerungskultur stärker in den Alltag einzubetten. Genau dort setzt die Ausstellung an: Sie lässt Gegenstände sprechen und zeigt, wie nah die Vergangenheit ist, wenn man sie betrachtet.