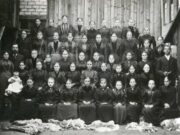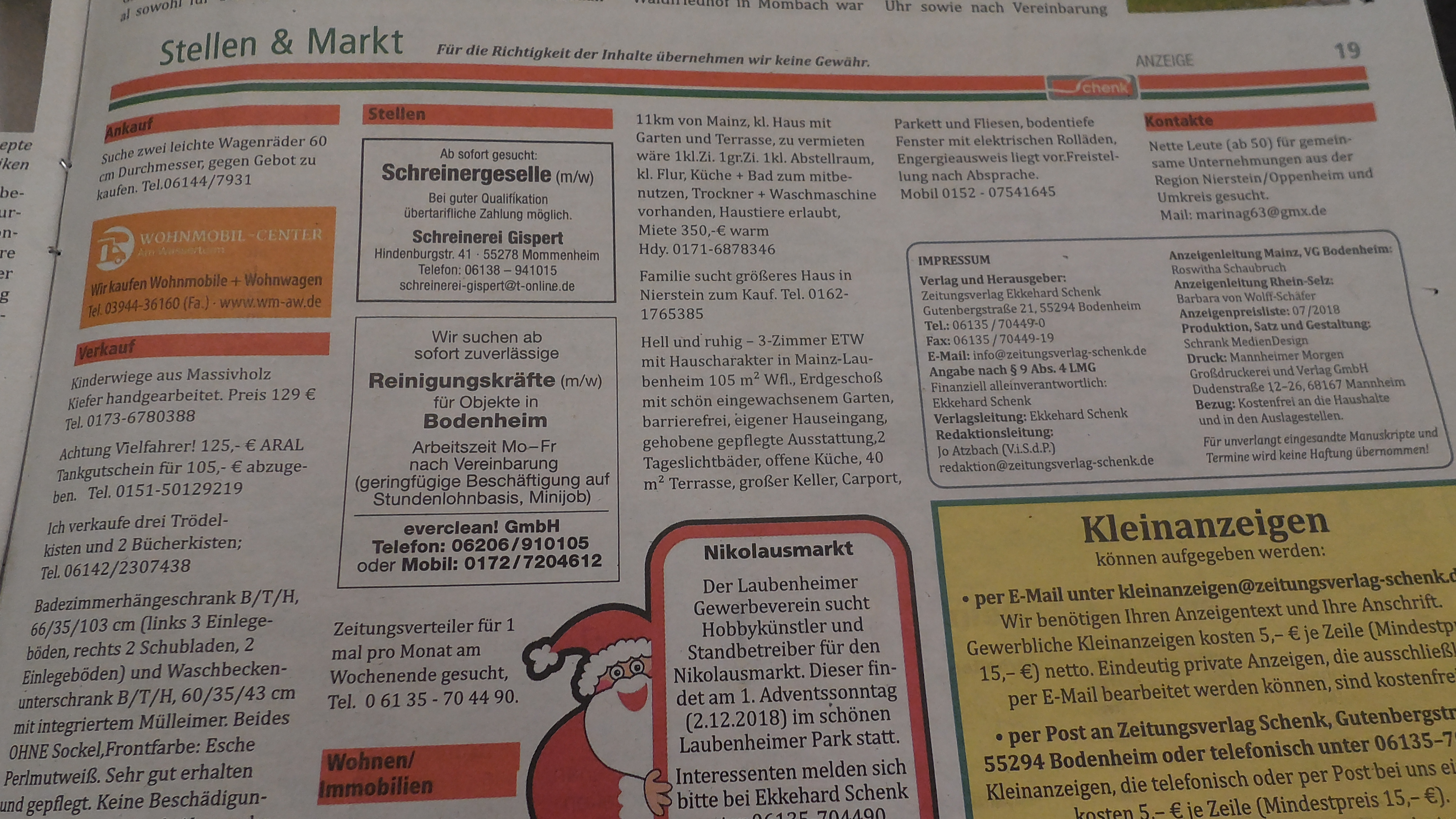MAINZ – Das jüdische Erbe von Mainz ist zusammen mit den Spuren der jüdischen Vergangenheit in Speyer und Worms zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden. „Ein Traum ist wahr geworden. SchUM ist Weltkulturerbe“, sagte Mainzer OB Michael Ebling beim Festakt im Innenhof des kurfürstlichen Schlosses. Zur Erklärung: SchUM setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der hebräischen Bezeichnungen für die drei Städte: Schpira, Warmaisa und Magenza. Dabei wird in der hebräischen Leseart in diesem Fall der Buchstabe Waw wie ein U vorgetragen.
Im Antrag auf die Anerkennung der UNESCO spielte Mainz mit dem jüdischen Friedhof, der an die reiche religiöse und kulturelle Geschichte des mittelalterlichen Judentums erinnert, eine Trumpfkarte aus. Zwar existierte schon im 10. Jahrhundert in Mainz eine jüdische Gemeinschaft. Von Spuren des Quartiers aus jener Zeit wahlweise des späteren Ghettos überdauerte bis in die Gegenwart nichts Sichtbares.
Anders als beim Judensand. Der jüdische Friedhof an der Mombacher Straße bewahrt zahlreiche Grabsteine, von denen die ältesten aus dem 11. Jahrhundert stammen. Der Besuch des Friedhofs soll „auf diesem hoch sensiblen Ort“ nun eingeschränkt bleiben, versicherte Ebling.Die Ruhe der Toten sei auf jüdischen Begräbnisstätten unantastbar: Im August werde es Führungen über den Friedhof geben.
Zudem laufen die Planungen zur Gestaltung und Aufwertung des Areals weiter. „2022 wird etwas zu sehen sein.“ Touristische Projekte, wie die SchUM-Rad-Route und die SchUM-App, die nun um Mainz erweitert werden wird, sollen die 1000-jährige jüdische Stadtgeschichte verdeutlichen. „Ab jetzt wird sie fortgesetzt. Masel tow und Shalom“, wünschte Ebling.

Für die Mainzer jüdische Gemeinde drückte Anna Kischner die Freude über die Ehrung durch die Kommission aus. Sie erinnerte an Magenza als „die Mutter aller SchUM-Gemeinden“ und zog als Beispiel Solomon ben Simon aus der 1. Hälfte des 12. Jahrhunderts heran, für den Mainz „der Schild und Panzer aller Gemeinden, deren Ruf in allen Ländern verbreitet ist“, gewesen sei.
„Was für ein Erbe wird von ihm angepriesen!“ Sie zitierte weiter: „An einem Orte waren vereinigt: Thora, Größe, Reichtum, Ehre, Weisheit, Demut, Wohltätigkeit, Wehr und Schutz gegen Gesetzübertretung“. Zum Weltkulturerbe gehören daher nicht nur „mittelalterliche Monumente, sondern die Traditionen, Gelehrsamkeit“. Sie erinnerte zugleich daran, dass das „ewiges Ruherecht auf dem Judensand zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert wiederholt geschändet und die Grabsteine in Toren oder Festungsanlagen der Stadt verbaut“ worden seien.
„Viele Grabsteine tauchten im 19. Jahrhundert wieder auf.“ Zuletzt 18 Neufunde: „18 mal eingraviertes Wort Chaim, das für das Leben steht“, bemerkte Kischner. „Das jüdische Leben in Mainz.“ Sie stellte zudem den Zusammenhang zwischen den „Steinen aus dem Judensand und jenen der neuen Synagoge“. „Sie bilden die Brücke, auf der wir zusammen in die Zukunft gehen“.